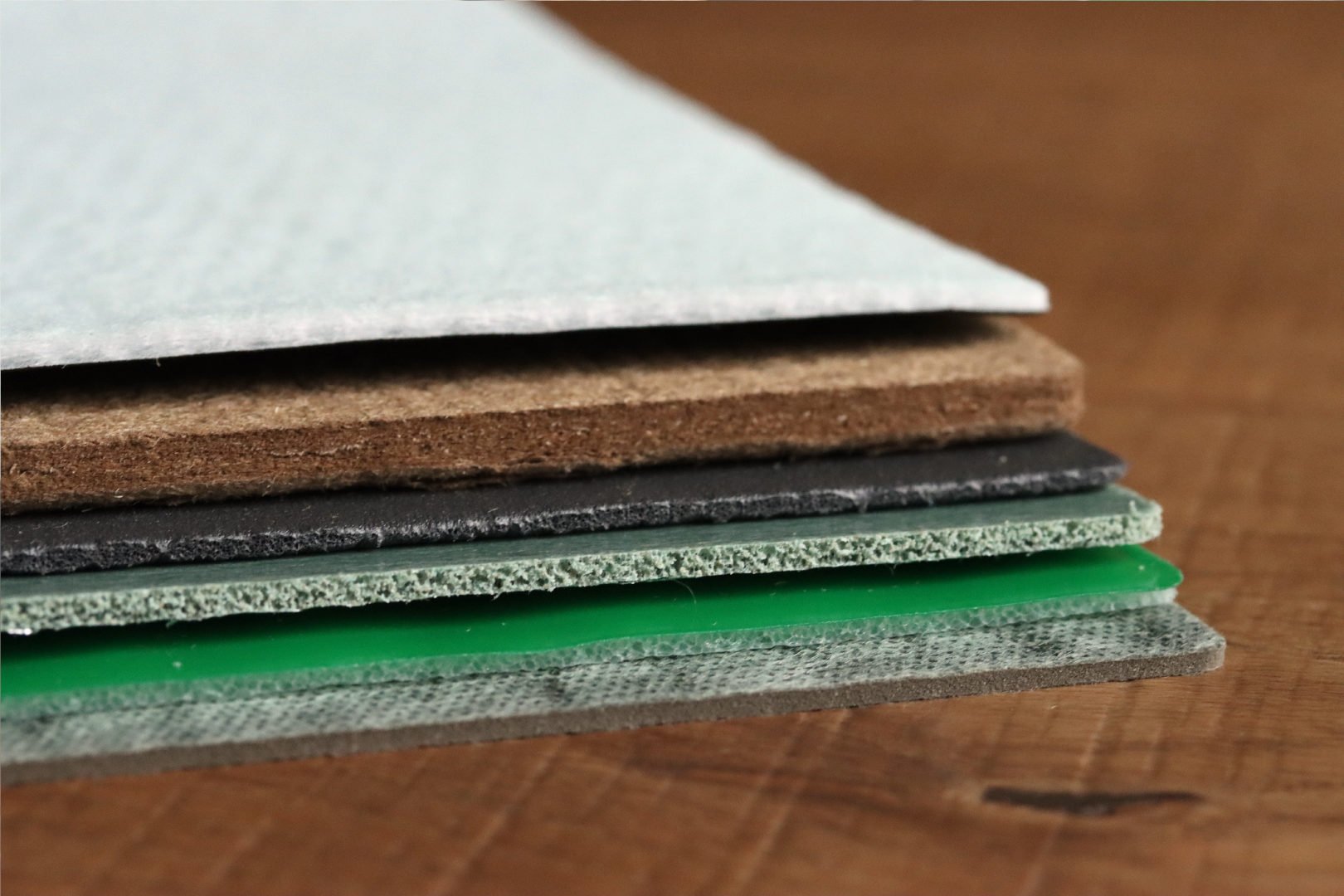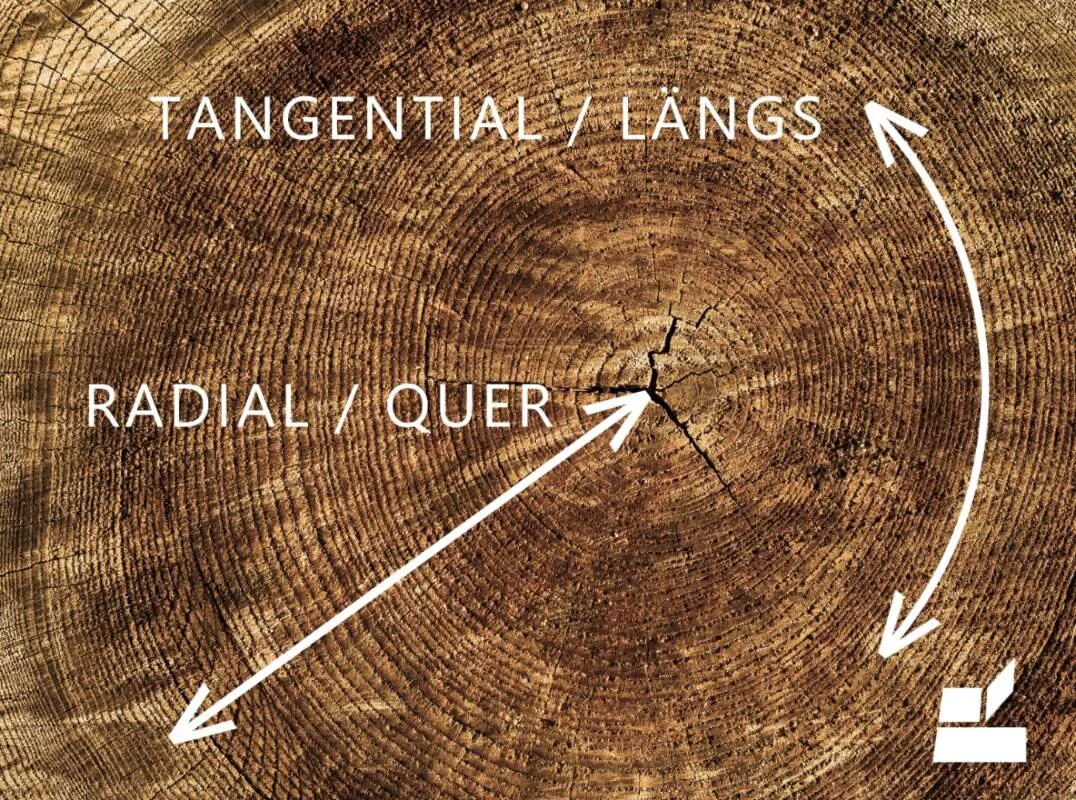Die Preise für Parkett sind so unterschiedlich wie deren Qualität. Meist ist dies jedoch auch aus gutem Grund so.
Es gibt einige Holzböden, die sehr günstig sind, und es gibt andere, die beinahe unbezahlbar sind. Aus praktischen Gründen konzentrieren wir uns in diesem kurzen Artikel jedoch auf den groben Durchschnittspreis für Parkett in der Deutschschweiz.
Wir beantworten in den nächsten Abschnitten, was denn ein Quadratmeter Parkett kostet und auf welche Details Sie beim Kauf achten sollten.
Was kostet ein m² Parkett im Schnitt?
Im Normalfall kostet ein m² Parkett rund 70 bis 120 Franken. Dies beinhaltet jedoch lediglich die Materialkosten des qualitativ guten Holzbodens.
Der Preis inklusive Verlegearbeiten und sonstigen Kosten beläuft sich somit in der Regel auf 110 bis 160 Franken pro m² für einen durchschnittlichen Parkettboden.
Mit solchen Preisen dürfen Sie also für ein fertig verlegtes Parkett rechnen, welches Ihnen im Schnitt 30-40 Jahre lang Freude bereitet.
Preise und werte für ParkettE verschiedener Kategorien:
| Kategorie: | Günstig | Durchschnittlich | Teuer | High-End |
|---|---|---|---|---|
| Preis pro m²*: | 40-70 CHF | 70-120 CHF | 120-180 CHF | 180+ CHF |
| Inkl. Verlegung*: | 80-110 CHF | 110-160 CHF | 160-220 CHF | 220+ CHF |
| Lebensdauer*: | ca. 10-20 Jahre | ca. 20-40 Jahre | ca. 40-60 Jahre | ca. 60-200+ Jahre |
| Robustheit*: | Normal | Gut | Sehr gut | Maximal |
*Diese Angaben sind Richtwerte und weder abschliessend noch ohne Ausnahme. Ryser Böden
Günstiges Parkett: 40-70* Franken pro m²
Durchschnitts-Parkett: 70-120* Franken pro m²
Teures Parkett: 120-180* Franken pro m²
High-End Parkett: 180+* Franken pro m²
*Sämtliche Preisangaben gelten exklusive Verlegungs- und Nebenkosten.
Wie kommen wir nun auf diese Zahlen und wie sind solche Preise gerechtfertigt?
So berechnet sich ein Parkett-Preis:
Der Preis einer Parkett-Diele berechnet sich aus:
dem Wert der einzelnen verwendeten Roh-Materialien,
den Forschungs- und Entwicklungs-Kosten,
dem Preis der aufgewendeten Arbeit bei der Herstellung,
der Lager-Haltungs-Kosten,
dem subjektiven Wert des Hersteller-Names (= des „Brands“)
und den gewünschten Gewinn-Margen des Herstellers und des Verkäufers.
Alle Bestandteile zusammen ergeben zum Schluss den Gesamtpreis für den Endkunden. Hier ein praktisches Beispiel für Parkett XY:
Unser Beispiel-Parkett XY: Eiche in Rohholz-Optik gebürstet.
Preis-Berechnung für 1 m² Parkett XY:
Wichtige Notiz: Diese Berechnung ist lediglich als Beispiel zu verstehen und dient nicht als gänzlich zuverlässige Referenz, um die einzelnen Kosten der Bestandteile eines Parketts zu ermitteln.
Materialkosten: 15.00 (Nutzschicht: Eichenholz rustikal 4mm), 5.00 (Trägerschicht: Sperrholz 7-lagig)
Entwicklungs-Kosten: 10.00 (Design, Tests, Forschung und Marktrecherche etc.)
Arbeit: 20.00 (Löhne sämtlicher Beteiligten)
Lagerung: 5.00 (Mietkosten oder ähnliches)
Hersteller-Name: 10.00 (XY ist natürlich ein Top-Brand)
Gewinn-Marge: 15.00 (für Hersteller XY), 20.00 (Für Verkäufer)
Gesamtpreis für einen Quadratmeter Parkett XY: 100.- Franken
Die Kostenverteilung und die prozentualen Anteile der unterschiedlichen Punkte können natürlich stark variieren. Wie hoch der Materialkosten-Anteil am Gesamtpreis ist, ist sicherlich nicht für jedes Parkett gleich. Die Werte, die wir für Parkett XY verwendet haben, sollten lediglich als Veranschaulichung dienen.
Was macht ein Parkett teuer?
Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, gibt es einige Faktoren, die den Preis einer Parkett-Diele bestimmen. Zwei der Faktoren, die den Preis eines Parketts schnell in die Höhe treiben, sind zum einen das verwendete Roh-Material, und zum anderen die Anzahl und die Dauer der benötigten Arbeitsschritte.
Die Sortierung des Parketts macht ebenfalls einen grossen Teil des Preises aus. Je Astfreier und ebenmässiger die Optik, desto hochpreisiger ein Parkett – zumindest in der Regel.
Längere und breitere Dielen kosten ebenfalls mehr, da grosse und breite Bäume schlichtweg seltener und unhandlicher sind. Das Format eines Parketts spielt demnach auch eine grosse Rolle, wenn es um Parkett-Preise geht.
Im Generellen gilt: Je exklusiver das Holz, je grösser das Format, je ruhiger die Oberflächen-Optik und je feiner und detailreicher die Verarbeitung, desto teurer ist das Endprodukt.
Hochwertige Parkette können so ohne weiteres weit über 150 Franken pro Quadratmeter kosten. Solche Holzböden bestehen meist aus sehr edlen Hölzern und wurden entweder von Hand oder mit sehr teurer Maschinerie geschaffen.
Sehr günstige Parkette werden meist aus minderwertigem Holz erschaffen, welche anschliessend mit einer oder mehreren dünnen (meist billigen) Lack- oder Öl-Schichten versehen werden. Es sind oftmals Dielen in kleinen Formaten, bei denen, aufgrund schlechterer Verarbeitung und dünneren Nutzschichten, eine Lebensdauer von lediglich 20-30 Jahren zu erwarten ist.
Solche „Billig-Dielen“ sind demnach zwar einmalig günstiger, jedoch, im Vergleich zu teuren Parketts und über die Dauer mehrerer Generationen gesehen, wiederum kosten- und aufwand-intensiver.
Preis-Schwankungen
Sie haben auf Ihrer Suche im Netz bestimmt auch schon bemerkt, dass die Preise für Parkett stark variieren können. Selbst dann, wenn die Parkette sonst nahezu identisch wirken. Welche Gründe kann das haben?
Einerseits, sind es der „Hersteller-Name“ und dessen Preisvorstellungen, die oftmals einen grossen Teil des Endpreises ausmachen. Andererseits jedoch, ist es hauptsächlich die Parkett-Qualität, die für die wirklich deutlichen Preis-Schwankungen unter vermeintlich gleichwertigen Holzböden sorgt.
Die Qualität eines Bodens aus Holz hängt von vielen Faktoren ab, die wir in unserem entsprechenden Artikel abdecken. Wir empfehlen dringendst, diesen Artikel zu lesen! Sie erfahren in diesem Artikel alles, was Sie über hoch- und minderwertiges Parkett wissen müssen.
Wie erklärt es sich, dass die Preise für identische Produkte bei verschiedenen Händlern unterschiedlich sind?
Dies ist natürlich eine sonderbare Angelegenheit. Preisunterschiede im Bereich von +/- 5% sind normal und sollten kein Grund zur Sorge sein. Solche Unterschiede sind oftmals auf Lager-Kosten und individuellen Margen-Vorstellungen zurück zu führen.
Spannender wird es, sobald sich die Kosten pro m² Parkett (ohne Verlegung) über 20% unterscheiden. Dies kann nur wenige Gründe haben:
1. Einer der Händler hat vergünstigte Einkaufs-Konditionen. Dies wäre die wünschenswerte Ursache.
2. Einer der Händler verlangt einfach mehr (höhere Unkosten, teurere Service-Leistungen etc.). Dies wäre eine durchaus tolerierbare Ursache.
3. Einer der Händler will ein wenig „schummeln“. Dies wäre die eher besorgniserregende Ursache.
Als oberste Regel bei sämtlichen am Bau beteiligten Firmen gilt: Fragen Sie nach der Zusammensetzung der Kosten. Der Betrag ist immer erklärbar - und muss es auch sein!
Ja, leider kann es vorkommen, dass Sie auf einen weniger seriösen Verkäufer treffen, der Sie ein bisschen manipulieren will. Deshalb raten wir Ihnen, auch stets ein weiteres Angebot von einem anderen Berater einzuholen – ausser Sie kennen und vertrauen einer bestimmten Firma bereits. So haben Sie stets einen Referenzwert.
Manchmal ist es so, dass ein Angebot tatsächlich zu gut ist, um wahr zu sein. Vorsicht deshalb vor zu „grosszügigen“ oder reisserischen Kauf-Konditionen. Wie wir in unserem Artikel über „den Preis eines Bodenlegers“ bereits schon geschrieben haben, ist nicht immer alles Gold, was (mit günstigen Angeboten) glänzt.
Die 10 Schritte zum erfolgreichen Parkett-Kauf
Wie soll man beim Parkett-Kauf vorgehen und auf welche Dinge muss man dabei achten? Die 10 Schritte zum Erfolg.
Achten Sie beim Kaufen eines Parketts auf folgenden Ablauf, werden Sie für Jahrzehnte mit Ihrer Anschaffung zufrieden sein:
Definieren Sie ein Budget (mit Spielraum nach oben – diesen werden Sie brauchen).
Notieren Sie sich die wichtigsten Eckdaten Ihres Wunsch-Parkettbodens oder suchen Sie nach Bildern.
Treffen Sie sich zum Beratungsgespräch mit einem Bodenleger Ihres Vertrauens.
Erzählen Sie Ihrem Berater von Ihren Budget- und Parkett-Vorstellungen.
Lassen Sie sich von Ihrem Fachmann (oder -Frau) beraten. Diese/r will Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt verkaufen, welches wahrscheinlich stark an der Obergrenze Ihres Budgets kratzt. Er/Sie stellt Ihnen (hoffentlich) mehrere ähnliche Optionen vor.
Denken Sie daran: Sie wollen das teurere Parkett, weil es wahrscheinlich das langlebigere und unproblematischere ist. Sie wissen es nur noch nicht… Haben Sie unseren Artikel über „Wie erkennt man Qualität bei Parkett?“ gelesen? Wenn nicht, holen Sie dies jetzt nach und lesen Sie anschliessend hier weiter. Keine Sorge, dieser Link öffnet sich in einem neuen Fenster.
Lassen Sie sich Muster der Parkette Ihrer engeren Auswahl mit nach Hause geben und testen Sie diese aus. Legen Sie sie auf den Boden bei Tageslicht und unter künstlichem Licht und probieren Sie sich vorzustellen, wie der Holzboden ganzflächig wirken wird. Einige Bodenleger-Betriebe erlauben Ihnen sogar, die Holz-Muster mit Saucen, Wein und anderen Flecken-Verursachern zu besudeln, um die Widerstandskraft gegen Flecken zu testen.
Wiederholen Sie die Schritte 3-7 für mindestens einen anderen Betrieb – ausser Sie halten es nicht für nötig, weil Sie der ersten Firma vertrauen.
Fordern Sie von den Betreiben Offerten an und vergleichen Sie diese. Sämtliche Offerten werden mit grösster Wahrscheinlichkeit über Ihrem erwarteten Budget liegen (das ist normal).
Nehmen Sie Rücksprache mit den einzelnen Betrieben, fragen Sie nach Rabatten und entscheiden Sie sich erst anschliessend für die für Sie beste Option. Wir raten Ihnen hierbei dringendst, nicht zu sehr auf den Endbetrag zu achten – Es gibt wichtigere Aspekte beim Parkett-Kauf, als das Geld.
Ein gutes Beratungsgespräch macht den Unterschied - und Sie wollen es ja schliesslich schön haben, nicht?
Die Faustregel für Parkett-Preise
Um Ihnen die Kaufentscheidung noch weiter zu vereinfachen, haben wir folgende Faustregel zusammengestellt:
Bitte beachten Sie, dass die Angaben approximativ und lediglich als Richtwerte zu verstehen sind. Es existieren viele Parkett-Modelle, die nicht eindeutig zuzuordnen sind.
Günstiges Parkett = 40-60* Franken pro m² | Lebensdauer ca. 20-30 Jahre | Nutzschicht ca. 3 mm | Robustheit normal.
Durchschnitts-Parkett = 60-100* Franken pro m² | Lebensdauer ca. 30-40 Jahre | Nutzschicht ca. 4 mm | Robustheit gut.
Teures Parkett = 100-150* Franken pro m² | Lebensdauer 40-60 Jahre | Nutzschicht 4+ mm | Robustheit sehr gut.
High-End Parkett = 150+* Franken pro m² | Lebensdauer 60-200 Jahre | Nutzschicht 5+ mm oder Massiv-Parkett | Robustheit maximal.
*Sämtliche Preisangaben gelten exklusive Verlegungs- und Nebenkosten.
Wählen Sie ein für Sie geeignetes Segment aus. Wir empfehlen in der Regel, sich für ein leicht überdurchschnittliches Parkett (irgendwo zwischen „Durchschnitt“ und „Teuer“) zu entscheiden. Diese haben meist das beste Kosten/Nutzen-Verhältnis.
Die Kosten von Parkett Verlegen pro m² in der Schweiz
Was kostet 1m² Parkett verlegen in der Schweiz?
Jemanden für das Verlegen von Parkettböden zu engagieren kostet Schweizweit somit in der Regel zirka 40 Franken pro Quadratmeter. Je nach Auftrag, Ortschaft und Betrieb kann dieser Betrag aber grösser oder kleiner ausfallen.
Verständlicherweise werden sämtliche Bodenbeläge teurer, wenn man sie verlegen lässt, statt wenn man sie beispielsweise selbst verlegt. Dies ist auch bei Parkettböden der Fall.
Im Normalfall lohnt es sich, sobald Sie einen neuen Boden Kaufen, einen Parkettleger/in anzustellen, welche/r den Holzboden gleich verlegt. Was Sie für diesen Service jedoch bezahlen, kann stark variieren und hängt von vielerlei Faktoren ab.
Diese Faktoren besprechen wir deutlicher in unserem Artikel über die Preise von Bodenlegern. Vorab jedoch die drei wichtigsten Fragen:
1. Wo in der Schweiz befinden Sie sich?
Die Kosten pro verlegtem m² Parkett sind in der Regel leicht höher in den Kantonen Zürich, Zug und Luzern. Andere Kantone, Regionen oder Ortschaften können wiederum erstaunlich günstig sein.
2. Mit welchem Betrieb haben Sie es zu tun?
Nicht überraschend ist wohl die Tatsache, dass kein Parkettleger-Betrieb einem anderen gleicht. Ein Holzboden kaufen und verlegen lassen kann bei Firma A deutlich teurer sein als bei Firma B. Meist korreliert aber der Preis des Betriebs mit der Qualität und Langlebigkeit des verlegten Bodens.
3. Wie viel, welches Holz und wo wird verlegt?
Grössere Aufträge kosten für gewöhnlich weniger pro m². Dasselbe gilt für Aufträge in Räumlichkeiten, die so quadratisch oder rechteckig sind wie möglich. Im Generellen gilt, je einfacher die Parkettböden zu verlegen sind und je weniger Aufwand pro Quadratmeter betrieben werden muss, desto günstiger.
Wie bereits in diesem Artikel beschrieben, belaufen sich die Kosten pro verlegtem m² Parkettboden gesamthaft auf rund 100 bis 140 Franken. Dies gilt zwar als Richtwert für den Kanton Zürich, ist aber auch nicht gänzlich verkehrt als Faustregel für die ganze Schweiz.
Unser Tipp für Sie: Wählen Sie den Verlege-Service gemäss der Qualität Ihres ausgesuchten Bodenbelags. Informieren Sie sich vorab Online über passende Betriebe. Es wäre doch eher schade, wenn Sie Ihren teuren Boden von unerfahrenen Billiganbietern unfachmännisch verlegen lassen würden, nicht?
Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Artikel auf Ihrer Suche nach dem idealen Parkettboden behilflich sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Artikel teilen würden, um anderen Personen, die in einer ähnlichen Situation sind, ebenfalls behilflich zu sein.
Wir empfehlen zudem, unsere Artikel zu abonnieren oder weiterhin in unserer Sammlung von wissenswerten Artikeln zu stöbern.
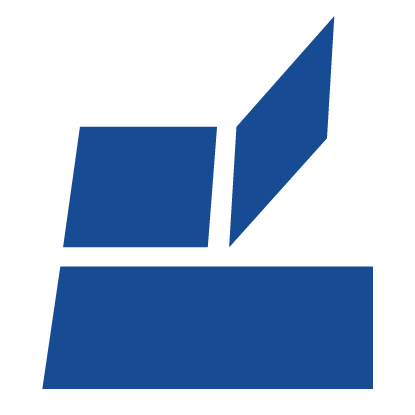






![Trittschalldämmungen und Parkett [wann, wie und welche?]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5c93a58e348cd95059ce19cd/e625507f-a7d9-46ed-9558-6886a84e4c17/Ryser+Boeden+Trittschall-Daemmungen+und+Parkett+Banner.jpeg)
![Parkett und Fussbodenheizung [Die ultimative Analyse]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5c93a58e348cd95059ce19cd/1626078089916-V57K1PIFJR0JKTK7ZLVT/Ryser+Boeden+Parkett+und+Fussbodenheizungen+BANNER.jpg)